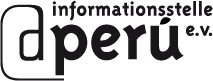Bei diesem Artikel handelt es sich um eine leicht angepasste und übersetzte Version des Blogartikels „Actors of vigilance: Indigenous environmental monitoring in Amazonia” in Vigilanzkulturen vom 16. April 2014.
Ankommen im Forschungsfeld
„ […] es gibt eine Redensart: Wir arbeiten mit Vertrauensgeschwindigkeit […]. Im Kontakt mit indigenen Gemeinschaften bedeuten Beziehungen viel. Transparenz, Gegenseitigkeit und gemeinschaftliches Arbeiten auf Vereinbarungen zu gegenseitigem Nutzen hin ist diesen Gemeinschaften sehr wichtig“, erklärt Tyler Jessen von der University of Victoria in British Columbia [1]. Damit beschreibt er zentrale Aspekte in der wissenschaftlichen Zusammenarbeit mit indigenen Gruppen, die auch für die ethnographische Forschung im Rahmen des Projekts „Jaguar, Drohne, Mensch: Indigene Wachsamkeit in Amazonien“ (SFB Vigilanzkulturen an der LMU München) bestimmend sind. Erst das gegenseitige zwischenmenschliche Vertrauen, dessen Voraussetzung der persönliche, oftmals zeitintensive Kontakt vor Ort ist, ermöglichen eben auch ein vertrautes Sich-Bewegen im zunächst fremden Forschungsfeld. Im Kontext des Projekts, das die Organisation und das Verständnis von Vigilanz im indigenen Umwelt-Monitoring untersucht, bedeutet dies im ersten Schritt, jene Menschen und Institutionen kennenzulernen, die vor Ort die entsprechenden Monitoringvorhaben umsetzen. Der explorative Forschungsaufenthalt von Prof. Dr. Anna Meiser und Jonas Bauschert, M.A. im Januar 2024 hatte demnach zum Ziel, in Peru und Ecuador Kooperationen aufzubauen und die verschiedenen Akteurssettings zu verstehen. Während der Reise trafen die beiden Wissenschaftler:innen u.a. Partneruniversitäten, im Amazonasgebiet ansässige indigene Organisationen, nationale wie internationale (Nicht-) Regierungsorganisationen, die lokale Bevölkerung sowie indigene vigilantes bzw. monitores (Umweltwächter:innen).
Der Artikel verdeutlicht auf Basis der ersten Forschungsphase die Diversität der zentralen Akteure sowie das Zusammenspiel dieser im Vigilanz-Gefüge. Denn, “[e]s ist am Ende nicht die Einzelperson, welche Vigilanz leistet, […], sondern es sind die Kombinationen oft sehr heterogener Elemente, welche die zu erzielende Funktion erst hervorbringen oder effizient stabilisieren können“ [2]. Dabei ist im Hinblick auf das Projekt zu beachten, dass sowohl Einzelpersonen und Institutionen als auch technische Geräte, wie beispielsweise Smartphones und GPS-Geräte, und nicht-menschliche Akteure in den Blick genommen werden, die ganz im Sinne Bruno Latours in einem Handlungsnetzwerk auftreten [3]. In der explorativen Forschung ging es jedoch darum, zunächst die organisationalen Akteure kennenzulernen, die dann im Weiteren den Zugang zu den vigilantes selbst und ihren Vorgehensweisen ermöglichen.
Zugang zum Forschungsfeld: Organisationen als Akteure des Umwelt-Monitoring
1. So lassen sich zunächst indigene Organisationen identifizieren, die unterschiedlich organisiert sind – international (z.B. alle neun Länder des Amazonasbeckens umfassend), regional (z.B. alle ethnisch organisierten Verbände in einem nationalen Amazonasgebiet umfassend) und auf Basis der ethnischen Zugehörigkeit. Sowohl die im Forschungsfeld siedelnden Machiguenga (Peru) als auch die Shuar (Ecuador) werden durch mehrere politische Föderationen repräsentiert (siehe unten). In Ecuador sprach Anna Meiser mit Vertreter:innen der Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), die die regionalen indigenen Verbände aller Amazonasländer vereint, sowie mit mehreren gewählten Mitgliedern der Confederación de las Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana (CONFENIAE). Diese wiederum repräsentiert die elf indigenen Ethnien des ecuadorianischen Amazonasgebiets, die in rund 1500 Gemeinden siedeln; die CONFENIAE arbeitet dabei eng mit den politischen Organisationen dieser elf Völker zusammen. Den indigenen Organisationen in Ecuador, aber auch in Peru ist gemein, dass sie für sich in Anspruch nehmen, die Umwelt und die natürlichen Rohstoffe zu schützen, die indigenen Territorien zu verteidigen und sich für die Revitalisierung indigenen Wissens und der Kultur einzusetzen. Nur so sei eine indigene Selbstbestimmung möglich – für die wiederum das Monitoring der indigenen Wächter:innen die Voraussetzung sei, argumentiert Marco Martínez, Shuar und Koordinator der COICA für Territorium und natürliche Ressourcen.

Denn die Wachsamkeit über den Amazonas-Regenwald schließe sehr viel mehr mit ein als „nur“ die Beobachtung von Flora und Fauna und die Kontrolle über die Gebietsgrenzen einer politischen Gemeinde (comunidad); sie beziehe sich ebenso auf die Begleitung von Konflikten innerhalb und zwischen den comunidades, die Wahrung der Menschenrechte in den jeweiligen Siedlungen, die Implementierung von partizipativen Entscheidungsprozessen sowie die Beachtung der kulturell tradierten Normen und Gebote. Für die Realisierung dieser ganzheitlichen Aufgabe müssten die Wächter:innen aus verschiedenen Wissensquellen schöpfen: Neben den neuen Technologien, die durch nationale und internationale Nichtregierungsorganisationen bereitgestellt werden (siehe unten), seien dies auch das Wissen der älteren Generationen, etwa jenes über die Tier- und Pflanzenwelt, aber auch die Kenntnis der Mythen und der „heiligen Stätten“ (u.a. Flüsse, Wasserfälle). Denn an diesen heiligen Stätten könne man mythische Figuren antreffen – etwa verkörpert durch Tiere wie den Jaguar oder die Anakonda –, die wiederum selbst über den Wald wachten, so der Shuar [4]. Dem Jaguar, dem größten Säugetier des Amazonas-Regenwaldes, werden viele Eigenschaften zugeschrieben – u.a. die, dass er sehr gut sieht. So mag es nicht verwundern, dass auf einem Schmuckstück der Machiguenga nur ein Organ des abgebildeten Jaguarkopfes vollständig abgebildet war: die Augen. Wohl auch aus diesem Grund bezeichnen die Waorani in Ecuador die indigenen Wächter:innen als meñebai –zu Deutsch: „ich bin ein Jaguar“ [5].

Die Notwendigkeit der Wachsamkeit über den Regenwald beruht aber nicht nur auf den sehr lokalen Bedürfnissen und kulturell übermittelten Praktiken, sondern ist für die vigilantes ebenso ein Unterfangen mit globaler Reichweite. So formuliert etwa die COICA auf ihrer Website, „dass unsere Existenz geprägt ist von der Verteidigung des Lebens und Amazoniens, um weiter der Samen der Erde zu sein und die Mutter Erde zu bewahren – damit der lebendige Planet den Fortbestand der heutigen und zukünftigen Generationen sichert [6]. Für die monitores dient ihre Wachsamkeit nicht nur der indigenen Bevölkerung vor Ort, sondern sie hat gleichsam die weltweite Relevanz Amazoniens im Fokus.
2. Diese lokal-globale Komponente wird von indigenen Organisationen aufgegriffen, indem sie mit nationalen und internationalen Nichtregierungsorganisationen zusammenarbeiten, die gezielt regionale sowie kommunale (indigene) Initiativen und Prozesse unterstützen und stärken. Um deren Ansatz und Vorgehen besser nachvollziehen zu können, besuchte Jonas Bauschert u.a. die Rainforest Foundation (RFUS) sowie das Instituto del Bien Común (IBC) in Iquitos, im Norden Perus, und sprach mit Vertreter:innen über deren Ansatz. Beide NGOs betonten, dass sie keine neuen Monitoring-Projekte initiieren, sondern bereits bestehende Projekte in indigenen comunidades unterstützen. Es gelte, so Rolando Rodriguez Arevalo, RFUS-Mitarbeiter und Fachberater für Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO), das Wissen der indigenen Wächter:innen kennenzulernen und anzuerkennen sowie zu unterstützen [7]. Denn “[t]he contribution of Indigenous peoples to science is crucial for understanding the territory, traceability, and the origin of forest resources” [8]. Das Vigilanz-Setting basiert daher auf dem lokalen, indigenen Verständnis des Territoriums und seiner Ressourcen in Kombination mit externer technischer Unterstützung. Die Nutzung von Drohnen, Smartphones und GPS-Geräten wird durch Schulungen erklärt und ermöglicht. Dem gegenüber betont Ana Rosita Rodríguez vom IBC, “la vigilancia indígena es como la base”, und jede:r in der Gemeinschaft kann vigilante sein. So werden Aufgaben und Zuständigkeitsbereiche verteilt, die regelmäßig rotieren. Hierdurch gibt es nicht nur einzelne wenige monitores, sondern eine Vielzahl, die das gesamte Territorium und die vorhandenen Ressourcen überwachen. Denn die indigene Vigilanz ist etwa auch dann von zentraler Bedeutung, wenn Gebietsstreitigkeiten oder andere territoriale Auseinandersetzungen zwischen den Gemeinden auftreten. Drohnen allein helfen da nicht weiter und lösten keine Konflikte, so Rosita Rodríguez [9]. Es brauche in den indigenen Gemeinden genauso konkrete Zuständigkeiten und Absprachen sowie eine breite Kenntnis über das Territorium. Hier greifen lokales und überregionales Wissen ineinander.

3. Einen anderen Ansatz verfolgt das Programa de Monitoreo Ambiental Comunitario del Bajo Urubamba (PMAC), welches das Umwelt-Monitoring entlang des unteren Urubamba-Flusses koordiniert. Die Hauptverwaltung des Programms befindet sich in Camisea, der Distrikthauptstadt von Megantoni, in der Provinz La Convención des Departamento Cusco im Süden Perus gelegen. Der Ort ist nur über eine längere und beschwerliche Reise, zunächst auf dem Landweg und anschließend mit dem Boot zu erreichen. PMAC ist “una instancia técnica de vigilancia socioambiental conformada por hombres y mujeres de las comunidades Machiguenga” [10] und wird von den drei indigenen Dachorganisationen CECONAMA, COMARU und FECONAY [11] getragen. Koordiniert wird das Programm von der Nichtregierungsorganisation Pronaturaleza, die verschiedene Sozial- und Umweltprojekte in Amazonien durchführt. Es wird suggeriert, dass die drei indigenen Verbände maßgeblich für die Durchführung und die inhaltliche Ausrichtung des Programms verantwortlich sind. Nach genauerer Betrachtung und Gesprächen mit lokalen Vertreter:innen wurde jedoch deutlich, dass ein Großteil der Daten durch das international agierende Rohstoff-Unternehmen Pluspetrol verwaltet wird, das für die Finanzierung der indigenen Organisationen zuständig ist. Im Fall von PMAC geht es somit zuvorderst darum, die vom Unternehmen errichteten Installationen in den indigenen Territorien auf ihre korrekte Funktionsweise hin zu überprüfen und gegebenenfalls Schäden oder Lecks zunächst an Pluspetrol selbst zu melden. Darüber hinaus erhält das Unternehmen durch die Vigilanz-Aktivitäten der monitores Zugang zu Informationen über das Territorium sowie die soziale und politische Situation der indigenen Bevölkerung. Wie in Abbildung 4 sichtbar wird, handelt es sich um weitgreifende Monitoring-Aktivitäten, die sowohl ökologische Faktoren in den Blick nehmen als auch das soziale Umfeld der lokalen comunidades. Vigilanz zeigt sich hier in doppelter Gestalt. So werden zwar auf der einen Seite die Umweltveränderungen und -auswirkungen dokumentiert und beobachtet, gleichermaßen überwacht aber das Unternehmen wiederum diese Vigilanz-Aktivitäten. Wie einzelne Gespräche vor Ort gezeigt, werden diese PMAC-Aktivitäten von einigen Akteuren in der Region freilich nicht unkritisch gesehen.

4. Schließlich existieren in der Forschungsregion entlang des Río Urubamba auch Monitoring-Projekte, die durch das peruanische Umweltministerium koordiniert werden. Das trifft etwa auf das Naturschutzgebiet Santuario Nacional de Megantoni zu, welches von einer Untereinheit des Ministeriums verwaltet wird (Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, SERNANP). In diesem Fall geht es vorrangig um Umwelt- und Naturschutzmaßnahmen sowie die Überwachung der Flora und Fauna, aber auch kultureller bzw. „heiliger Orte” der Machiguenga: „El Santuario Nacional Megantoni busca conservar de manera intangible los ecosistemas que se desarrollan en las montañas de Megantoni, manteniendo intactos sus bosques y fuentes de agua […], así como los valores culturales y biológicos como el Pongo de Mainique, lugar sagrado para el pueblo Machiguenga” [12]. César Aliaga Guerrero, Koordinator des nationalen Schutzgebietes macht deutlich: “No somos nada sin los vigilantes de la zona” [13]. So arbeiten laut Aliaga Guerrero zwölf angestellte Parkwächter:innen mit weiteren ehrenamtlichen lokalen vigilantes zusammen. Das indigene Erfahrungswissen spiele hierbei eine zentrale Rolle für den Umweltschutz und nur so könne das Gebiet weiträumig kontrolliert werden. Allerdings kehrt sich damit die kosmologische Rollenzuschreibung des Hüters über den Wald um. Denn es ist nun der Mensch, der den Jaguar überwacht – obgleich dieser nach wie vor die mythologische Proto-Figur des Wächters über den Wald ist (siehe oben); so zeigen die gelben Punkte in Abbildung 5 des nationalen Schutzgebiets die durch die monitores dokumentierten Jaguarspuren.

Perspektiven für das Forschungsfeld
Bereits nach diesem kurzen Forschungsaufenthalt ist eines deutlich geworden: In das Umwelt-Monitoring sind verschiedene Personen und Institutionen eingebunden – die indigenen Gemeinden und Organisationen, nationale und internationale Nichtregierungsorganisationen, die Rohstoff fördernden Unternehmen und der Nationalstaat. Das macht die Vigilanz vor Ort zu einer facettenreichen Praxis, die – je nach Akteur – auf unterschiedlichen Konzeptionen, Foci und Zielsetzungen beruht. Das Verständnis und die damit einhergehende Legitimierung der Wachsamkeit über den Amazonas-Regenwald schöpfen aus unterschiedlichen Quellen, den Erkenntnissen der konventionellen Wissenschaft, aber auch der indigenen Mythologie. Vigilanzaktivitäten richten sich dabei manchmal stärker auf die allgemeine Veränderung von Flora und Fauna sowie die Kontrolle über ein Naturschutzgebiet, manchmal stärker auf die Überwachung der Integrität des eigenen Territoriums oder auch von sozialen Konflikten – oder sie gilt der „doppelten“ Wachsamkeit eines Unternehmens wie Pluspetrol. Dementsprechend hat auch die Wachsamkeit in Amazonien verschiedene Absichten, auch wenn diese nicht notwendigerweise im Widerspruch zueinanderstehen bzw. im Sinne einer ganzheitlichen Vigilanz gleichzeitig verfolgt werden. Das gilt etwa für den Schutz des Regenwaldes, seiner „heiligen Stätten“ oder auch die Verteidigung der indigenen Selbstbestimmung in den betroffenen Territorien. PMAC will hingegen eine offensichtlich verantwortungsvolle und nachhaltige Unternehmenspolitik betonen – und bemüht sich so um internationale gesellschaftliche Akzeptanz der Rohstoffförderung in Amazonien.
Zu den hier beschriebenen Akteuren im Forschungsfeld gehören zuletzt auch wir als Forscher:innen aus dem Ausland. Wir beobachten die indigene Wachsamkeit vor Ort – und werden dabei, so die Erfahrung aus der explorativen Feldforschung, auch selbst beobachtet oder überwacht. Das zeigte sich etwa im peruanischen Bajo Urubamba an den verschiedenen Bitt- und Genehmigungsschreiben, die an politische Autoritäten zu richten waren, den schriftlichen Registrierungen an den Kontrollposten jeder comunidad oder auch an der Frage, ob ein Interview aufgenommen werden konnte oder man sich auf den Rahmen eines informellen Gesprächs verständigte. Als Teil dieser vigilanten Praxis verstehen wir auch die regelmäßigen, nun virtuell stattfindenden Unterredungen mit den Vertreter:innen indigener Gemeinden, Nichtregierungsorganisationen sowie des universitären Kooperationspartners, der Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba (UNIQ). In diesen Treffen wird ausgelotet, wie der nachfolgende Forschungsaufenthalt von Jonas Bauschert im Bajo Urubamba umgesetzt werden kann – in welchen comunidades, zu welchen Bedingungen und mit welchen Erwartungen.
In diesem Sinne spiegelt sich in dem behutsamen und vorsichtigen Prozess des Kennenlernens, der aufmerksamen Wahrnehmung des Anderen die von Tyler Jessen angesprochene „Vertrauensgeschwindigkeit“ wider. Es wird sich zeigen, wie schnell oder langsam sie sich im Rahmen des Forschungsprojekts entwickeln und wie intensiv sie von den oben skizzierten Wachsamkeitspraktiken begleitet werden wird.
[1] BR-Radiowissen (17.01.2024): Traditionelles Wissen. Indigene und die Spitzenforschung. [Letzter Zugriff: 18.01.2024].
[2] Brendecke, Arndt et al. (2022): Vigilanzkulturen. Transformationen – Räume – Techniken. Finanzierungsantrag 1. Juli 2023 – 30. Juni 2027 [Internes Dokument].
[3] Vgl. u.a. Latour, Bruno (2007): Eine neue Soziologie für eine neue Gesellschaft. Einführung in die Akteur-Netzwerk-Theorie, Frankfurt am Main: Suhrkamp.
[4] Interview mit Marco Martínez am 03.01.2024.
[5] Alvarado, Ana Cristina (05.10.2022): Las guardias indígenas toman fuerza en Ecuador para proteger y conservar sus territorios. [Letzter Zugriff: 18.03.2024].
[6] COICA: Sobre COICA. [Letzter Zugriff: 18.03.2024].
[7] Interview mit Rolando Rodriguez Arevalo am 04.01.2024.
[8] Rainforest Foundation (14.11.2023): Indigenous tech camps. An incubator for Indigenous-led solutions in the Peruvian Amazon. [Letzter Zugriff: 22.03.2024].
[9] Interview mit Ana Rosita Rodríguez am 05.01.2024.
[10] Programa de Monitoreo Ambiental Comunitario del Bajo Urubamba (PMAC BU). [Letzter Zugriff 22.3.2024].
[11] CECONAMA: Comunidades Nativas Machiguenga; COMARU: Consejo Machiguenga del Río Urubamba; FECONAYY: Federación de Comunidades Nativas Yine Yami.
[12] SERNANP (01.01.2019): Santuario Nacional de Megantoni. [Letzter Zugriff: 21.03.2024].
[13] Interview mit César Aliaga Guerrero am 13.01.2024.